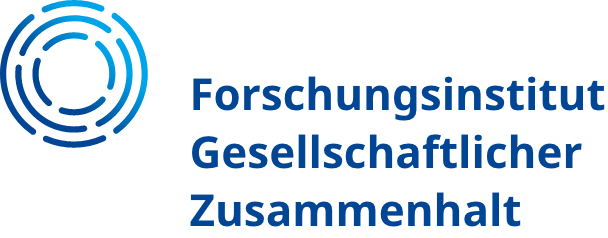Öffentliche Leistungen und gleichwertige Lebensverhältnisse
LEI_F_05 – Projekt des FGZ Leipzig
Zielsetzung / Fragestellung
Das Teilprojekt LEI_F_04: Die gesellschaftliche Wahrnehmung und politische Verhandlung des Ziels gleichwertiger Lebensverhältnisse in Ländern und Kommunen – Responsivität, Dialog und die Re-Konstitutionalisierung von Ordnung leistet einen (1) begrifflich-theoretischen, (2) empirisch-analytischen (mit gesellschaftlichen Zusammenhalt als abhängige Variable) und (3) regional vergleichend-kontextualisierenden Beitrag zum Forschungsprogramm des FGZ, indem es die gesellschaftliche Perzeption gleichwertiger Lebensverhältnisse und ihrer makrostrukturellen Determinanten, den Zusammenhang mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und die Responsivität der Politik (einschließlich institutionellen Wandels) demgegenüber untersucht. Es kooperiert besonders eng mit dem Leipziger Projekt LEI_F_05 „Öffentliche Leistungen und gleichwertige Lebensverhältnisse“ und profitiert dabei von der interdisziplinären Kooperation mit Finanzwissenschaftler*innen. Zugleich unterscheidet es sich aber von diesem in mehrfacher Hinsicht. Erstens liegt der Fokus nicht auf Finanzen und policies, sondern auf politics (Perzeption, Diskurs) und polity (Rekonstitutionalisierung). Zweitens wird neben quantitativen Methoden in ausgeprägter Weise qualitative Methodik genutzt.
Das Teilprojekt geht davon aus, dass unter den gewandelten Rahmenbedingungen bisherige Wahrnehmungen öffentlicher Güter und politisch-institutionelle Ordnungsarrangements nicht mehr stabil sind und dies den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Vor diesem Hintergrund will es herausfinden, wie responsiv politische Akteur*innen gegenüber gesellschaftlichen Erwartungen hinsichtlich des im Grundgesetz verankerten Ziels gleichwertiger Lebensverhältnisse sind und wie Dialog wirkt, um daraus Handlungsvorschläge für Politik, Gesellschaft sowie für die politische Bildung ableiten zu können. Dem dienen folgende vier Arbeitspakete:
A: Im ersten Paket wird in Fokusgruppeninterviews untersucht, welchen Stellenwert Bürger*innen dem Staatsziel gleichwertige Lebensverhältnisse in Relation zu anderen politischen Themen beimessen und mit welchem Sinngehalt, welchen Bezugsgrößen und mit welchen politischen Argumentationen es in Bezug auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt verbunden wird. Setzen sie die Bewertung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse beispielsweise in Beziehung zur Verteilung öffentlicher oder individueller Güter, im Vergleich West / Ost, Reiche / Arme, früher / heute? Wie wird die Verhandlung / Thematisierung gegebenenfalls mit anderen Themen (lokale Probleme, „kulturelle Überfremdung“, Elitenfeindlichkeit oder Ähnliches) verknüpft? Dies wird vergleichend in teilstrukturiert moderierten Gruppeninterviews untersucht. Sie werden in vier Bundesländern (zwei West, zwei Ost) mit je zwei relativ ähnlichen sozioökonomischen, siedlungs- und wahlverhaltensbezogenen Profilen durchgeführt (RP, NDS, SN, BB), und zwar jeweils im ländlichen und städtischen Raum. Die Daten werden mit MAXQDA inhaltsanalytisch ausgewertet.
B: Im zweiten Paket wird mithilfe einer MAXQDA-gestützten Dokumentenanalyse für den Zeitraum 2015 bis 2021 die Responsivität der Politik gegenüber den gesellschaftlichen Wahrnehmungen zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse analysiert: Sind die Themen Gegenstände in den gewählten Kreis- und Landesvertretungen der genannten Fälle gewesen? Entspricht die Thematisierung den in der Gesellschaft beobachteten Mustern? Welche Präferenzen hatten welche Akteur*innen und worin bestehen die Hauptkonflikte? Kommt es zu Versuchen der Re-Konstitutionalisierung von Ordnung in Bezug auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse und die Verteilung öffentlicher Güter? Der Zuschnitt des Untersuchungszeitraums ermöglicht die Beobachtung für je unterschiedliche Legislaturperioden und Veränderungen über Zeit.
C: Die Befunde der Untersuchung werden auf internationalen Konferenzen und im eigenen internationalen Forschungsnetzwerk zur Diskussion gestellt sowie in den untersuchten Regionen in Dialogveranstaltungen mit Bürger*innen und Politiker*innen vorgestellt und diskutiert. Dabei wird zum einen Feedback zur Interpretation der Daten eingeholt, die für die wissenschaftliche Qualität der Untersuchung wichtig ist und in die Bewertung eingeht. Zum anderen wird in Kooperation mit dem Projekt HAN_F_05 „Transfer erforschen – Transfer gestalten: Evidenzbasierter Wissenstransfer als Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt“ durch Vorher-Nachher-Befragungen und teilnehmende Beobachtung untersucht, inwiefern der Dialog einen Effekt auf die jeweilige Sichtweise von Politiker*innen und Bürger*innen auf gleichwertige Lebensverhältnisse hat. Sind solche Veranstaltungen also geeignet, jeweils die Akzeptanz bestimmter Positionen zu fördern? Dies soll für unterschiedliche Dialogformattypen verglichen werden.
D: Aus den Projektbefunden werden in einem letzten Schritt policy-Empfehlungen abgeleitet. Diese richten sich zum einen auf die Responsivität gewählter Politiker*innen und den eventuellen Bedarf der Re-Konstitutionalisierung von Ordnung. Zum anderen werden in Kooperation mit dem Projekt HAN_F_05 Vorschläge für die Politikvermittlung über Dialogveranstaltungen formuliert, die auch als Element der politischen Erwachsenenbildung eingesetzt werden können. Diese werden innerhalb des FGZ, insbesondere innerhalb von Cluster 2, diskutiert.
Im anschließenden Fortsetzungsprojekt sollen die Befunde in einem dezidiert internationalen Vergleich geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Zudem soll der Transfer internationaler gestaltet und evaluiert werden. Langfristiges Ziel ist die Erarbeitung eines Erklärungsmodells, das auch über Deutschland hinaus, für europäische Gesellschaften, verallgemeinerbar ist.
Thematischer Bezug zu gesellschaftlichem Zusammenhalt
Der Begriff des „gesellschaftlichen Zusammenhalts“ ist in den Wirtschaftswissenschaften kein typischer Erkenntnis- und Untersuchungsgegenstand. Die Annäherung an das Forschungsfeld zum gesellschaftlichen Zusammenhalt erfolgt jedoch über die Erforschung der (Un-)Gleichheit von Einkommen, Vermögen und materiellen Lebensverhältnissen, die aus wirtschaftlichen Transaktionen resultiert (Piketty 2015). Im Vergleich der Disziplinen und Herangehensweisen an den Untersuchungsgegenstand gehört der ökonomische Blickwinkel damit zu den Ansätzen, die egalitäre soziale Beziehungen als Voraussetzung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einordnen. Unterschiede in den Lebensverhältnissen, insbesondere in der Ausstattung mit öffentlichen Leistungen, bestimmen die materielle und wahrgenommene Lebensqualität. Angesichts steigender beziehungsweise stagnierender Ungleichheit in den letzten Jahrzehnten stehen Verteilungsfragen wieder verstärkt im Fokus der Debatte, sowohl im Wissenschaftskontext als auch im Kontext der angewandten Finanz- und Wirtschaftspolitik (Wirtschaftsdienst 2019). Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist in der Bundesrepublik Deutschland ein zentrales staatspolitisches Ziel (Henneke 2019). Dies klingt auch in zwei Stellen des Grundgesetzes an, wo sie explizit genannt wird (Art. 72 Abs. 2 GG, im Art. 106 Abs. 3 S. 2 GG sogar „einheitlich“). Die Orientierung an „gleichwertigen Lebensverhältnissen“ ist anders als beim Neologismus des „gesellschaftlichen Zusammenhalts“, kein neuartiges Konzept, sondern ist bereits seit Jahrzehnten als Leitlinie staatlichen Handelns verankert.
Staatliche Aufgabenträger (Gebietskörperschaften, Sozialversicherungsträger, öffentliche Unternehmen) sind durch ihre Tätigkeit Garanten für Daseinsvorsorgeleistungen, für die Bereitstellung technischer und sozialer Infrastruktur sowie für einen materiellen Ausgleich zwischen verschiedenen Akteur*innen. Zunehmende Ungleichheiten im Bundesgebiet, ein regelmäßig beklagter Rückzug des Staates aus bestimmten Räumen, die massive Vernachlässigung der öffentlichen (vor allem kommunalen) Infrastruktur sowie die fortgesetzte Privatisierung staatlicher Leistungserbringung stellen potenzielle Quellen für ein Auseinanderdriften von Individuen und gesellschaftlichen Gruppen dar (Fink et al. 2019; Sixtus 2019). Aktuell werden diese Themen insbesondere im Zusammenhang mit dem Braunkohleausstieg oder den Diskrepanzen zwischen urbanen Zentren und ländlichen Räumen diskutiert (Hesse et al. 2019; Hochhuth 2012; Potrafke / Rösel 2019). Da die genauen Zusammenhänge zwischen finanz- und regionalpolitischen Entscheidungen und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt vielfach unvollständig oder gänzlich unbekannt sind, verspricht eine intensive Beforschung im Forschungscluster „Strukturen, Räume und Milieus des Zusammenhalts“ (s.u.) tiefgreifende analytische Erkenntnisse und vielfache Transferansätze. Zudem stellen sich zunehmend die Fragen, ob einerseits die Realisierung gleichwertiger Lebensverhältnisse konkret messbar und herstellbar ist und ob andererseits gleichwertige Lebensverhältnisse überhaupt den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern. Dass die ökonomischen und politischen Konflikte bei der Umsetzung des Ziels gleichwertiger Lebensverhältnisse vielgestaltig und mitunter nicht auflösbar sind, wurde in diesem Jahr medienwirksam am Beispiel des Scheiterns der vom Bund eingesetzten „Kommission Gleichwertige Lebensbedingungen“ klar (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat; Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2019; Deutscher Städtetag 2019).
Für die genannten finanzwissenschaftliche Forschungsfragen und -ansätze bestehen vielfache Überschneidungen zu raumwissenschaftlichen, soziologischen sowie politikwissenschaftlichen Perspektiven, welche innerhalb des FGZ produktiv genutzt werden sollen.
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat; Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) 2019: Unser Plan für Deutschland – Gleichwertige Lebensverhältnisse überall. Berlin. Online verfügbar unter www.bmi.bund.de / SharedDocs / downloads / DE / veroeffentlichungen / themen / heimat-integration / gleichwertige-lebensverhaeltnisse / unser-plan-fuer-deutschland-langversion-kom-gl.pdf?__blob=publicationFile&v=4, zuletzt geprüft am 21.08.2019.
Deutscher Städtetag (Hrsg.) 2019: Städtetag zum Kabinettsbeschluss für gleichwertige Lebensverhältnisse, in: Städtetag aktuell, 7 / 19. Online verfügbar unter www.staedtetag.de / imperia / md / content / dst / veroeffentlichungen / dst_aktuell / 2019 / staedtetag_aktuell_7_2019.pdf, zuletzt geprüft am 11.12.2019.
Fink, Philipp; Hennicke, Martin; Tiemann, Heinrich 2019: Ungleiches Deutschland. Sozioökonomischer Disparitätenbericht 2019. Für ein besseres Morgen. Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn. Online verfügbar unter www.fes.de / ungleiches-deutschland , zuletzt geprüft am 30.04. 2019.
Henneke, Hans-Günter (Hrsg.) 2019: Gleichwertige Lebensverhältnisse bei veränderter Statik des Bundesstaates?, in: Schriften zum deutschen und europäischen Kommunalrecht 55, Stuttgart.
Hesse, Mario; Starke, Tim; Jänchen, Isabelle, Glinka, Philipp 2019: Prosperierende Städte, abgehängte Regionen? Empirische Untersuchung zu Wirtschafts- und Steuerkraft, in: Wirtschaftsdienst 99:10, 703-710. Online verfügbar unter https://archiv.wirtschaftsdienst.eu /
jahr / 2019 / 10 / prosperierende-staedte-abgehaengte-regionen-empirische-untersuchung-zu-wirtschafts-und-steuerkraft, zuletzt geprüft am 28.11.2019.
Hochhuth, Martin (Hrsg.) 2012: Rückzug des Staates und Freiheit des Einzelnen. Die Privatisierung existenzieller Infrastrukturen, in: Wissenschaftliche Abhandlungen und Reden zur Philosophie, Politik und Geistesgeschichte, Band 69, Berlin.
Piketty, Thomas 2015: The economics of inequality, Cambridge, MA.
Potrafke, Niklas; Rösel, Felix 2019: The Urban-Rural Gap in Health Care Infrastructure –
Does Government Ideology Matter?, in: ifo Working Papers 300. Online verfügbar unter www.ifo.de / DocDL / wp-2019-300-potrafke-roesel-urban-rural-gap-health-care-infrastructure.pdf, zuletzt geprüft am 11.06.2019.
Sixtus, Frederick; Slupina, Manuel; Sütterlin, Sabine; Amberger, Julia; Klingholz, Reiner 2019: Teilhabeatlas Deutschland. Ungleichwertige Lebensverhältnisse und wie Menschen sie wahrnehmen, Berlin. Online verfügbar unter https://wuestenrot-stiftung.de / teilhabe-atlas-deutschland, zuletzt geprüft am 10.09.2019.
Wirtschaftsdienst (Hrsg.) 2019: Regionalpolitik neu denken, in: Wirtschaftsdienst, Sonderheft, 99. Jahrgang, Sonderheft 2019. Online verfügbar unter https://archiv.wirtschaftsdienst.eu /jahr / 2019 / 13, zuletzt geprüft am 05.06.2019.
Projektleiter:innen und Kontakt
Prof. Dr. Thomas Lenk
Dr. Mario Hesse
Laufzeit, Cluster und Forschungsfelder
Laufzeit:
06 / 2020 – 05 / 2024Cluster und Forschungsfelder:
- Cluster 2: Strukturen, Räume und Milieus des Zusammenhalts
- C2: Milieu und soziale Ungleichheiten
- Cluster 3: Historische, globale und regionale Varianz des Zusammenhalts