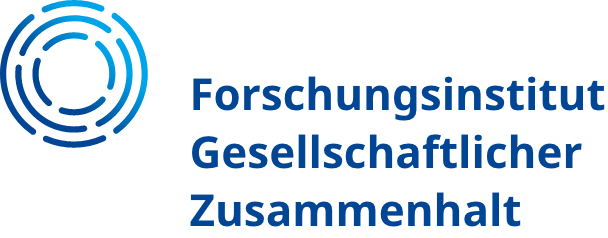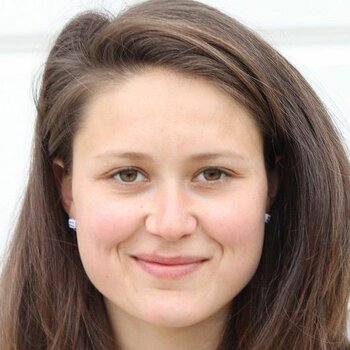Die gesellschaftliche Wahrnehmung und politische Verhandlung des Ziels gleichwertiger Lebensverhältnisse in Ländern und Kommunen – Responsivität, Dialog und die Re-Konstitutionalisierung von Ordnung
LEI_F_04 – Projekt des FGZ Leipzig
Zielsetzung / Fragestellung
In Deutschland ist das Ziel, für gleichwertige Lebensverhältnisse zu sorgen, im Grundgesetz verankert. Im Teilprojekt untersuchen wir die gesellschaftliche Wahrnehmung gleichwertiger Lebensverhältnisse und ihrer makrostrukturellen Determinanten. Wir prüfen, ob sich die Erwartungen und Sichtweisen von Menschen danach unterscheiden, wo sie wohnen, z.B. in einem kleinen Ort oder einer Großstadt, in Ost- oder Westdeutschland und in einer Kommune mit Wirtschaftswachstum oder einer strukturschwachen Region. Außerdem erfragen wir, worauf kommunale Spitzenverbände beim Thema gleichwertige Lebensverhältnisse Schwerpunkte setzen. Dies ermöglicht es uns zu prüfen, ob die Sichtweisen der Menschen von den kommunalen Spitzenverbänden gut abgebildet sind. All dies, so nehmen wir an, steht im Zusammenhang mit der Qualität des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Wir nutzen ein Mixed-Methods-Forschungsdesign. Wir arbeiten v.a. mit einer qualitativen Methodik, gestützt auf lokale Gruppendiskussionen und Interviews mit kommunalen Spitzenverbänden, die wir mithilfe von MAXQDA inhaltsanalytisch auswerten. Diese Datenbasis wird ergänzt um schriftliche Befragungen. Durch Kooperation mit dem Leipziger Teilprojekt „Öffentliche Leistungen und gleichwertige Lebensverhältnisse“ haben wir Zugriff auf finanzwissenschaftliche Forschungsergebnisse, beispielsweise zur kommunalen Ebene. Außerdem werten wir einen breiten Fundus verfügbarer wissenschaftlicher Literatur und weitere Quellen zur Einbettung und Kontextualisierung unserer Forschung aus.
Wo wir unterwegs waren
Wir sprachen mit Menschen in Orten, die das Spektrum der durchschnittlichen Rahmenbedingungen in Deutschland abbilden, d.h. wir gehen nicht nur in „abgehängte“ oder großstädtische Regionen. Wir führten in 6 Kommunen in 4 Bundesländern (Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen) Gruppendiskussionen durch. Wir sprachen auch mit den kommunalen Spitzenverbänden in diesen 4 Bundesländern.
Mit wem wir sprachen und worüber
In den 24 Gruppendiskussionen vor Ort in Kommunen wollten wir mehr zum Leben vor Ort, gleichwertigen Lebensverhältnissen und Erwartungen an die Politik erfahren. Dafür organisierten wir kleine Gesprächsrunden mit jeweils sechs bis acht Personen. Die Gruppen waren geschlechterparitätisch gemischt, bildeten die Altersstruktur der deutschen Bevölkerung und die unterschiedlichen sozialen Milieus gut ab. Um dies zu gewährleisten, kooperierten wir überwiegend mit lokalen Sportvereinen.
Wie wir unsere Ergebnisse weitergeben
Unsere Forschungsergebnisse fließen in die Lehre ein; wir vermitteln sie also beispielsweise an Lehramtsstudierende, die das Wissen künftig wiederum an ihre Klassen weitergeben. Wir führen regelmäßig öffentliche Veranstaltungen durch, in denen wir mit jungen Menschen und allen Interessierten über das Projektthema sprechen, so beispielsweise im Rahmen des Globe23-Wissenschaftsfestivals in Leipzig. Außerdem veröffentlichen wir Publikationen, halten Vorträge und berichten in Medien über unsere Erkenntnisse.
Projektleiter:innen und Kontakt
Prof. Dr. Astrid Lorenz
Projektmitarbeiter:innen
Luisa Pischtschan
Laufzeit, Cluster und Forschungsfelder
Laufzeit:
06 / 2020 – 05 / 2024Cluster und Forschungsfelder:
- Cluster 2: Strukturen, Räume und Milieus des Zusammenhalts
- C2: Institutionelle Strukturen und öffentliche Güter