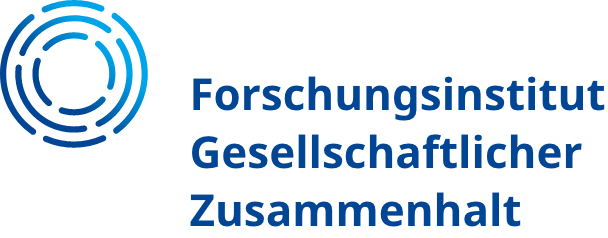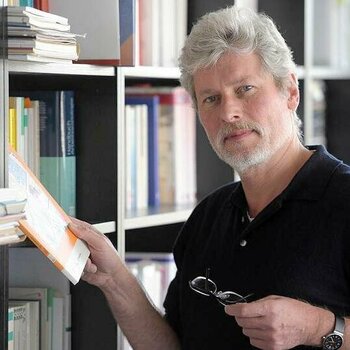Neue Instrumente bürgerschaftlicher Partizipation: Infrastrukturgenossenschaften
HAL_T_01 – Projekt des FGZ Halle
Zielsetzung / Fragestellung
Im Teilprojekt HAL_T_01 sollen institutionelle Bedingungen und organisationale Verfasstheit bürgerschaftlichen Engagements in Gestalt von Infrastrukturgenossenschaften in ausgewählten Kommunen und regionalen Projekten untersucht werden. Die daraus folgenden Bestandserhebungen und Analysen bilden die Grundlage für wissensbasierte Interventionen. Zentral sind dabei Formate der gleichberechtigten Koproduktion von Wissen zum Erhalt vorhandener und zur Entwicklung neuer Formate der Daseinsvorsorge, die gemeinsam bedarfsbezogen entwickelt und erprobt werden. Zur Koproduktion von Wissen gehört hierbei auch, dass Forscher*innen überregionales Wissen zu möglichen Problemlösungen recherchieren, analysieren sowie vor Ort gegebenenfalls bei der Implementation mitarbeiten. Wir gehen davon aus, dass insbesondere intermediäre Organisationen in der Regel wissen, welche ungelösten Aufgaben und Probleme sie bearbeiten und prozessieren. In innovativen Veranstaltungsformaten können Forscher*innen im Austausch mit Praktiker*innen an diesem Wissen partizipieren. Zudem sollen entsprechende Lösungswege mit aktiven Infrastrukturgenossenschaften, Vertretern der Kommunalverwaltungen sowie der Landespolitik und der Zivilgesellschaft in Workshops erörtert, Ressourcen gebunden und über mehrere Jahre weiterentwickelt werden. Als besonderer Aspekt soll auch untersucht werden, inwiefern bestehende „Standards“, d.h. normative und veraltungspraktische Vorgaben, die Durchführung von bürgerschaftlichen Initiativen hemmen. Dazu soll eine entsprechende Erhebung durchgeführt werden. Der wechselseitige Wissenstransfer soll die Akteure in die Lage versetzen, ihr Handeln wissensbasiert weiter zu entwickeln und Forscher*innen ermöglichen, ihre empirischen Befunde fortlaufend zu aktualisieren und die Folgen ihrer forschungsbasierten Interventionen zu reflektieren.
Das Teilprojekt HAL_T_01 nimmt eine zentrale Stellung innerhalb der Transferstrategie des FGZ Halle ein, weil es zusammen mit zivilgesellschaftlichen und regionalpolitischen Akteuren in koproduzierenden Formaten der public science institutionelle Verbesserungen entwickeln möchte, die die Selbststeuerungsfertigkeiten der Gesellschaft stärken. Aufgrund seiner Methodologie stellt es auch einen wichtigen Referenzfall im Rahmen der Transferausrichtung des FGZ dar.
Im Teilprojekt wird mit den Praxispartnern Kompetenzzentrum Soziale Innovation Sachsen-Anhalt, ausgewählten Infrastrukturgenossenschaften und Kommunen (u.a. Stadt Weißenfels), dem Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband – DGRV e.V. und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund zusammengearbeitet werden.
Zentrale Meilensteine des Teilprojektes sind Workshops zu Mehrgenerationen-Wohnungsgenossenschaften und Kultur-Infrastrukturgenossenschaften im Frühjahr 2021 ein Workshop zu sozialen Bürgergenossenschaften im Herbst 2022, die Beendung der Analyse zu Finanzbedingungen von Infrastrukturgenossenschaften im Januar 2021, die Finalisierung der Untersuchung zu Standard-Flexibilisierung Ende 2022, die Veröffentlichung des Ergebnisberichtes im November 2023.
Thematischer Bezug zu gesellschaftlichem Zusammenhalt
Die kommunale Daseinsvorsorge stellt in Deutschland traditionell ein zentrales Instrument zur Sicherung gleichwertiger Lebensbedingungen und damit auch des gesellschaftlichen Zusammenhalts dar. Durch die Selbstverwaltung in allen Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wird „vor Ort“ nicht nur die Verständigung über diese Themenfelder ermöglicht, sondern auch die Einbringung von Ideen und Prioritäten bei der Gestaltung der Lebensbedingungen gesichert. Hinzu kommt, dass die Bürger*innen direkt durch Bürgerentscheide mitwirken können. Schließlich ist auch die Zusammenarbeit mit Privaten (Public-Private-Partnerships) in diesem Bereich üblich. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben aber gezeigt, dass diese traditionellen Formen der Partizipation in mehrfacher Hinsicht nicht mehr ausreichen. Einmal fehlt es vielerorts an der ausreichenden Leistungsfähigkeit der Kommunalhaushalte, so dass freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, vor allem kulturelle Angebote, nicht fortgeführt werden können. Zum anderen empfinden die Bürger*innen die punktuelle Beteiligung durch Bürgerentscheide als unzureichend und suchen nach Möglichkeiten nachhaltiger Teilhabe. In beiden Bereichen eröffnet die Infrastrukturgenossenschaft Pfade einer nachhaltigen Teilhabe und verbessert zudem die finanziellen Grundlagen für die Koproduktion öffentlicher Güter. Dabei kann zwischen reinen Bürgergenossenschaften und durch Bürger*innen und Kommunen gemeinsam getragenen Genossenschaften unterschieden werden. Wenn die Kommunen dieses Instrument gezielt einsetzen, können sie auch soziale Innovation und Vielfalt verbessern. Da ein wichtiger Aspekt für die Gründung und Unterhaltung von Infrastrukturgenossenschaften auch deren Förderung darstellt, wird speziell untersucht, welche normativen Rahmenbedingungen (Standards) gegebenenfalls hinderlich sind und angepasst (flexibilisiert) werden sollten.
Projektleiter:innen und Kontakt
Prof. Dr. Winfried Kluth
Projektmitarbeiter:innen
Alena Marie Rathke
Laufzeit, Cluster und Forschungsfelder
Laufzeit:
06 / 2020 – 05 / 2024Cluster und Forschungsfelder:
- Transferprojekte