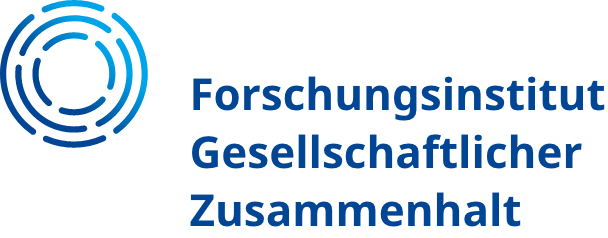Rechtsextremismus zwischen Normalisierung und Konfrontation: Befunde aus Eisenach
Abstract
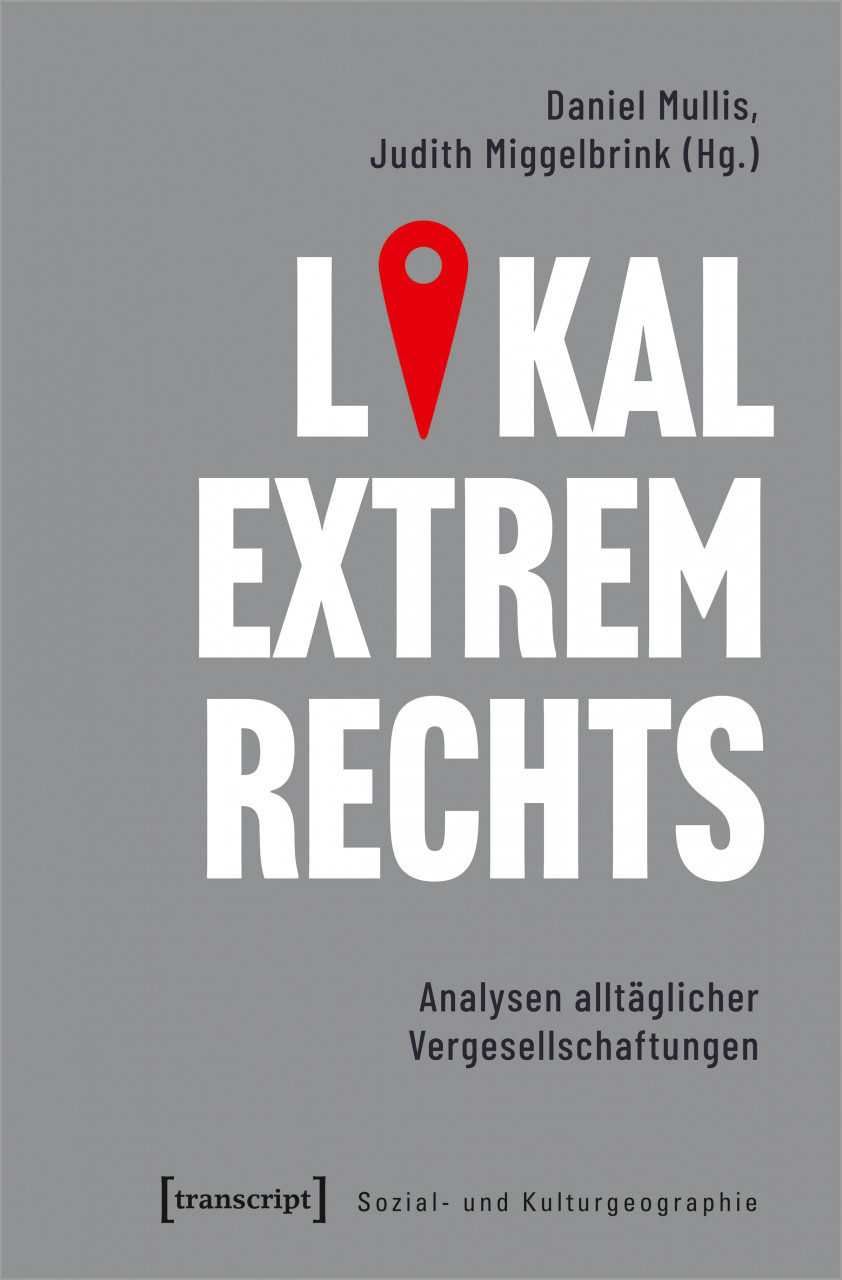
Wird Rechtsextremismus in ostdeutschen Sozialräumen thematisiert, ist oftmals von „Raumergreifung“ und von Normalitätsgewinnen die Rede. Diese drücken sich darin aus, „dass sich niemand mehr [oder zu wenige, Anm. der Autoren] besonders aufregt darüber, wenn rechtsextreme Gruppen in diesen Sozialräumen auftreten“ (Heitmeyer 2020: 7) und „ihre soziale Praxis als Normalität legitimiert oder hingenommen wird“ (Grünert/Raabe 2013: 17). Das Phänomen wird als Ausdruck einer geschwächten demokratischen Zivilgesellschaft gedeutet (vgl. Berg/Üblacker 2020: 12f.) – und es verweist auf die lange Kontinuität bzw. das Nachwirken der sogenannten „Baseballschlägerjahre“ (Christian Bangel) als Teil der Lebensrealität in Ostdeutschland.
File1
- Salheiser_Quent_Eisenach.pdf 241 KB
Quellen
Salheiser, Axel und Matthias Quent. 2022. Rechtsextremismus zwischen Normalisierung und Konfrontation: Befunde aus Eisenach. In: Lokal extrem Rechts: Analysen alltäglicher Vergesellschaftungen, hg. von Daniel Mullis und Judith Miggelbrink. Sozial- und Kulturgeographie 48. Bielefeld: transcript Verl, 2022.
Weiterführende Links
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-5684-8/lokal-extrem-rechts/